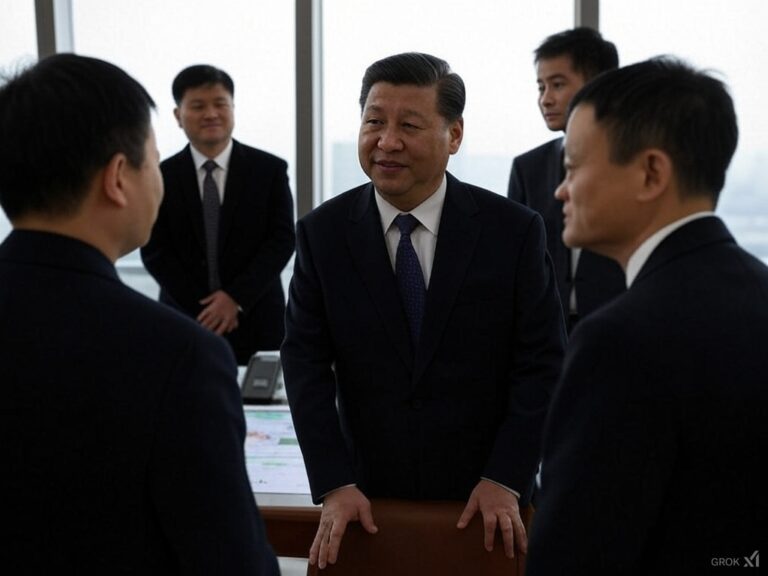In der zweiten Präsidentschaft Donald Trumps und der damit verbundenen Zolloffensive zeichnen sich die globalen Gewinner und Verlierer immer deutlicher ab. Während US-Industriegiganten wie U.S. Steel und Nucor von protektionistischen Maßnahmen profitieren, kämpfen multinationale Automobilkonzerne wie Toyota und BMW mit steigenden Kosten. Gleichzeitig intensivieren die BRICS-Staaten – angeführt von Chinas Sinopec und Indiens Reliance Industries – ihre Bemühungen, den Dollar zu umgehen. Für Unternehmen wie Samsung Electronics und Ford, die auf traditionelle Lieferketten angewiesen sind, entstehen dadurch neue Risiken. Die Frage ist nicht mehr, ob Trumps Politik den Handel verändert, sondern wie tief sie eine von geopolitischer Loyalität geprägte Unternehmenshierarchie verankern wird.
Zolleinnahmen beleben den Rust Belt
Die Zolleinnahmen des US-Finanzministeriums in Höhe von 180 Milliarden US-Dollar haben sich zu einem Rettungsanker für die heimische Industrie entwickelt. U.S. Steel sicherte sich Bundesaufträge im Wert von 3,2 Milliarden US-Dollar für Brücken- und Schienenprojekte in Ohio und Michigan. Nucor, gestärkt durch „Buy American“-Vorgaben, erweiterte sein Walzwerk in Indiana und schuf 1.200 neue Jobs. Die gezielte Abwertung des Euro um 12 % – eine Folge von Trumps Druck auf die Europäische Zentralbank – ermöglichte es Tesla, die Lithium-Importkosten um 15 % zu senken und die Produktion in der texanischen Gigafactory zu steigern.
Doch die Schattenseiten der Politik sind unübersehbar: Toyota, das 40 % seiner nordamerikanischen Fahrzeuge in mexikanischen Werken produziert, sieht sich mit 25 % Strafzöllen konfrontiert. Der Konzern stoppte den Bau einer 1,3 Milliarden US-Dollar teuren Fabrik in Guanajuato und verlagert Investitionen in teurere US-Standorte. Auch BMWs Werk in Spartanburg (South Carolina) – einst Vorzeigeprojekt der Globalisierung – kämpft mit Zöllen auf deutsche Komponenten, was die Gewinnmargen in diesem Quartal um 8 % schmälerte.
Politische Auswirkungen: Rüstungsdeals und zögerliche Zugeständnisse
Trumps „Sicherheit-gegen-Zölle“-Taktik beschert Lockheed Martin und Raytheon unerwartete Auftragsbooms. Deutschlands Zusage, F-35-Kampfjets im Wert von 6 Milliarden US-Dollar zu kaufen, bewahrte Volkswagen vor Auto-Zöllen, kostete den Konzern jedoch 14 % Marktanteil in der EU, da französische Rivalen wie Renault und Stellantis mit Preisdumping reagierten. Siemens Energy, zwischen die Fronten geraten, verlor einen 9-Milliarden-US-Dollar-Auftrag für Turbinenlieferungen an Saudi-Arabien nach deutschen Exportbeschränkungen – eine Lücke, die Chinas Shanghai Electric schnell füllte.
In Asien kämpft Samsung Electronics mit einer Doppelkrise: BRICS-affine Tech-Firmen fordern 30 % ihrer Zahlungen in Yuan, was teure Währungssicherungen erfordert, während US-Sanktionen gegen Chip-Exporte nach China die Produktion im Halbleiterwerk Xi’an stören. Der südkoreanische Konzern verlagerte 4 Milliarden US-Dollar nach Vietnam, wo VinFast zum Schauplatz eines Stellvertreterkonflikts wird. Das E-Auto-Startup expandiert seine Fabrik in North Carolina, um US-Lokalvorgaben zu erfüllen, und sichert sich Yuan-Kredite von BRICS-Banken für Nickelminen in Indonesien.
Wirtschaftliche Folgen: Gegensätze in Energie und Technologie
Die Energiewirtschaft spiegelt die globale Spaltung wider: Sinopec und Petrobras bewerten 45 % ihrer Ölexporte in Yuan und binden Saudi Aramco in ein Pilotprojekt für digitales Währungsclearing ein. Diese Verschiebung reduziert die Nachfrage nach Dollar-Öl und zwingt US-Frackingfirmen wie ExxonMobil, asiatische Lieferungen mit 12 % Abschlag zu akzeptieren. Reliance Industries umgeht Sanktionen durch ein Joint Venture mit Russlands Rosneft, das günstiges Urals-Öl in Yuan an indische Raffinerien liefert – ein Deal, der die Margen um 18 % steigerte, aber den Zugang zu europäischen Märkten erschwert.
In der Tech-Branche warnen Ford und General Motors vor Chip-Engpässen, da taiwanesische und südkoreanische Zulieferer BYD und Tata Motors priorisieren, die BRICS-Märkte dominieren. Intel, einst Spitzenreiter in Asien, konzentriert sich nun auf US-geförderte Projekte und gewann einen 2-Milliarden-US-Dollar-Vertrag des Pentagon für KI-Chips.
Ausblick: BRICS-Gegenstrategie und unternehmerische Zwickmühlen
Der BRICS-Gipfel in Moskau (Oktober 2025) droht die Finanzkonfrontation zu verschärfen. Durchgesickerte Pläne für ein „Bretton Woods II“-System enthüllen eine goldgedeckte Digitalwährung, die von China Construction Bank und Gazprombank für Energie- und Metalltransaktionen getestet wird. Goldman Sachs verzeichnete einen Anstieg von BRICS-Unternehmensanleihen um 300 %, die westliche Märkte umgehen – darunter Adani Green Energy und Sasol (Südafrika), die allein in Shanghai 14 Milliarden US-Dollar sammelten.
Für US-Firmen wachsen die Risiken: Während General Dynamics und Raytheon von Rüstungsaufträgen profitieren, drohen Apple und Microsoft der Ausschluss aus BRICS-Digitalprojekten. Selbst Tesla bleibt nicht verschont: Die Shanghai-Gigafactory könnte Subventionen verlieren, falls sie nicht teilweise Yuan-Zahlungen akzeptiert.
Was kommt als Nächstes?
Zwei Ereignisse stehen im Fokus: Trumps geplantes Abkommen mit Saudi-Arabien zur Ölpreisbildung in einem Dollar-Yuan-Mix, das Energiemärkte stabilisieren – oder weiter spalten – könnte, und die BRICS-Digitalwährung, die SWIFTs 70 %-Dominanz bei grenzüberschreitenden Zahlungen angreift.
Regionaler Fokus: Südostasiens Balanceakt
In Thailand sieht sich der Staatskonzern PTT Group mit Investorenprotesten konfrontiert, da er Flüssiggas-Exporte zwischen japanischen Dollar-Kunden und BRICS-Partnern in Bangladesch aufteilen will. Indonesiens PT Freeport riskiert US-Sanktionen, nachdem es 15 % seiner Kupferproduktion an Chinas Jiangxi Copper in Yuan verkaufte – ein Beispiel für die prekäre Gratwanderung der Region.